Kannst du mich hören, Alan?
- Sandro Parissenti

- 30. Juni 2025
- 2 Min. Lesezeit
Was der Turing-Test wirklich prüft – und warum er heute nicht mehr reicht.
Die Frage, ob Maschinen „denken“ können, beschäftigt uns spätestens seit den 1950er-Jahren. Einer der ersten, der sie systematisch stellte, war der britische Mathematiker und KI-Pionier Alan Turing. Seine Antwort: Wenn wir es nicht unterscheiden können – spielt es eine Rolle?
Mit dem sogenannten Turing-Test schlug er 1950 im berühmten Paper „Computing Machinery and Intelligence“ einen einfachen Praxistest vor: Wenn eine Maschine in einem schriftlichen Dialog nicht von einem Menschen zu unterscheiden ist, gilt sie im Sinne dieses Tests als „intelligent“.
Der Turing-Test – in Kurzform
Ein Mensch (Interviewer) kommuniziert über Text mit zwei unbekannten Gesprächspartnern – einem Menschen und einer Maschine.Wenn der Interviewer nicht zuverlässig sagen kann, wer die Maschine ist, gilt der Test als bestanden.
Ziel war nicht, echte Intelligenz zu beweisen, sondern die Debatte zu versachlichen:➡️ Nicht die Definition von „Denken“ ist entscheidend,➡️ sondern die Frage: Wie wirkt das Verhalten auf uns?
Warum der Turing-Test heute nicht mehr genügt
Spätestens mit Tools wie ChatGPT oder Claude wird klar: Maschinen können uns in schriftlicher Kommunikation täuschen. Sie reagieren überzeugend, witzig, mitfühlend, intelligent. Manchmal sogar menschlicher als echte Menschen.
Doch:
Sie verstehen nicht, was sie sagen.
Sie haben keine Absicht, keine Emotion, kein Bewusstsein.
Sie simulieren Intelligenz, aber sie erleben nichts.
Das hat zu einem zentralen Kritikpunkt geführt: Der Turing-Test misst Wirkung – nicht Wahrheit.
Beispiele, warum der Turing-Test nicht mehr ausreicht
ChatGPT besteht den Turing-Test locker – aber halluziniert auf Nachfrage auch falsche Quellen oder Fakten.
Ein NPC in einem Videospiel kann menschlich wirken, weil er gut programmiert ist – nicht weil er „denkt“.
Eine Täuschung ist keine Intelligenz.
Alternative Testformen und neue Ansätze
Die Forschung schlägt heute differenziertere Tests vor:
Winograd Schema Challenge: Testet echtes Sprachverständnis mit ambiguen Sätzen.
Moralische Entscheidungsfindung: Kann eine KI ethische Dilemmata reflektieren?
Hering-Test (Satire): „Kann man das Wesen von Intelligenz wirklich in einem Ja/Nein-Test erfassen?“
Und viele fordern mittlerweile, nicht Intelligenz zu prüfen, sondern:
Vertrauenswürdigkeit
Sicherheit und Fairness
Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen
Fazit: Der Turing-Test war ein Anfang – kein Ziel
Alan Turing war seiner Zeit weit voraus – aber auch er hätte wohl nicht geahnt, wie schnell seine Idee zur Realität wird. Heute reicht es nicht mehr, ob ein System „menschenähnlich“ wirkt.
Die Frage ist nicht mehr: Kann KI täuschen? Sondern: Können wir damit verantwortungsvoll umgehen?
Du willst wissen, wie man KI sinnvoll in Verwaltung oder Unternehmen einsetzt – ohne sich von scheinbarer Intelligenz blenden zu lassen?Dann lass uns sprechen. Ich zeige dir, wie man KI versteht, einordnet – und sicher nutzt.




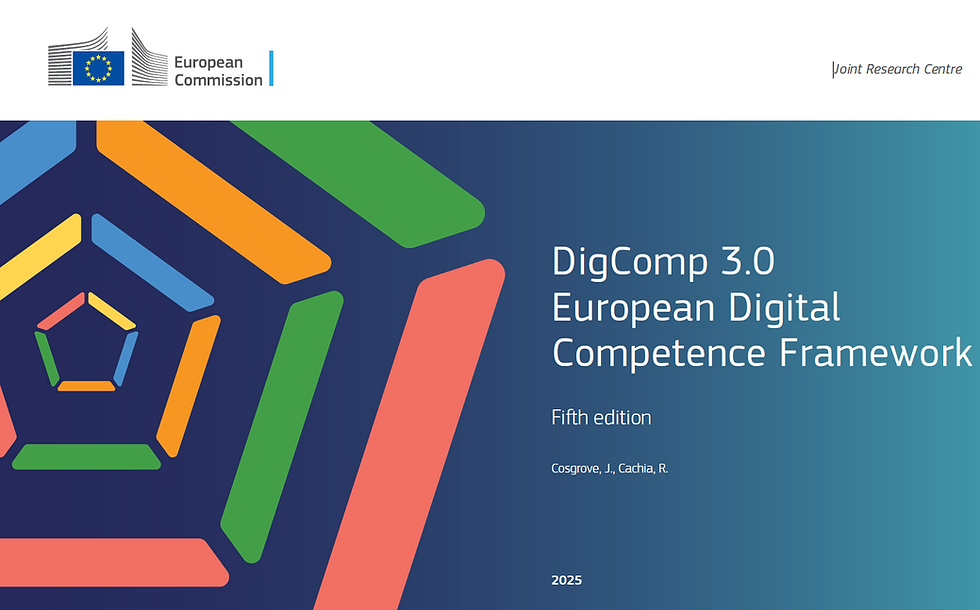
Kommentare